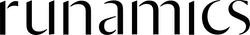Running Heals #3 - Die psychische Belastung im Leistungssport
Share

Sportpsychologin von Beruf
Vom Theater in die Charité
Liebe Mari, stell dich unseren Leser*innen doch bitte einmal kurz vor, was Du so treibst und wie Du dazu gekommen bist.
Hallo, mein Name ist Mareike Dottschadis, aber die meisten nennen mich einfach „Mari“. Seit etwas mehr als 2 Jahren arbeite ich als Sportpsychologin, u.a. am Olympiastützpunkt Brandenburg, aber auch als Freiberuflerin. Vorher war ich in einigen anderen Berufsfeldern aktiv, die sich nicht nach einem linearen Weg in die Sportpsychologie anhören, aber für meine heutige Tätigkeit super nützlich sind.
Eigentlich wollte ich, seit ich 9 Jahre alt war, Schriftstellerin werden und habe 12 Jahre lang an Wettbewerben, Schreibwerkstätten und Lesungen teilgenommen. Dann habe ich meine Liebe zum Theater entdeckt und ein paar Regiehospitanzen am Deutschen Theater und der Berliner Schaubühne gemacht, war mir bald aber sicher, dass mein beruflicher Weg weder ins Theater, noch an den Schreibtisch führt.
Also habe ich mich für einen Kombibachelor in Sportwissenschaften und Europäischer Ethnologie an der Humboldt Uni hier in Berlin entschieden. Schon da habe gemerkt, dass mich die psychische Komponente im Leistungssport am meisten fasziniert. Ich war damals studentische Mitarbeiterin in der sportmedizinischen Ambulanz der Charité und habe Leistungsdiagnostiken durchführt und ich fand es super spannend, wie sich Hochleistungssportler:innen unter Anstrengung, Druck und Schmerz motivieren können, im Vergleich zu Freizeitsportler*innen.
Nach dem Bachelor wechselte ich an die Business School Berlin, um einen Master of Science in Sportpsychologie zu absolvieren. Später kam dann noch eine Ausbildung zum systemischem Coach hinzu.
Vom Pferd in die Laufschuhe
Auch sportlich war mein Weg alles andere als geradlinig und geplant, ich komme auch nicht aus dem Leistungssport. Früher habe ich mal Ballett gemacht und dann über 10 Jahre voltigiert (Akrobatik auf Pferden). Ich witzele manchmal rum, dass das Laufen mich gefunden hat, weil ich eher aus Versehen zum Laufen gekommen bin.
Ich lief damals für eine Wette einen Marathon quasi ohne Vorbereitung – ich war damals vielleicht mal 7km am Stück gelaufen – und bin dabei darüber gestolpert, wie cool es ist, sich mit vielen anderen Menschen beim Laufen an die eigene Grenze zu bringen.
Das Laufen hat meinen beruflichen Weg seitdem beeinflusst und gelenkt. Ohne den Sport wäre ich nicht dort, wo ich jetzt bin und das empfinde ich wirklich als Geschenk. Seit 2017 arbeite ich als Lauftrainerin und als sportpsychologische Expertin und helfe Sportler*innen, ihre „Stärken zu stärken und Schwächen zu schwächen“, wie wir so schön im systemischen Coaching sagen.
"Go hard or go home" hilft nicht
Warum nicht Teil vom Trainingsplan?
Mit welchen Menschen kommst Du zusammen, sind es eher Leistungssportler*innen, die versuchen das letzte Quentchen in der Psychologie zu optimieren oder auch Freizeitläufer*innen, die sich etwas durch das Laufen erhoffen?
Auf Grund meines beruflichen Umfeldes am Olympiastützpunkt sind das in erster Linie Hochleistungssportler*innen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es auch im Hochleistungssport teilweise noch Überwindung kostet, mit einer Sportpsychologin oder einem Sportpsychologen zusammenzuarbeiten.
Dabei kann der Kopf auf dem höchsten Niveau auch am Ende alles entscheiden, wenn es um wenige Prozent Leistungsunterschied geht. Die meisten Profis und auch Freizeitsportler*innen versuchen, ihre Leistung auch über andere Bereiche wie Ernährung und Regenerationsmanagement positiv zu beeinflussen.
Ich würde mir wünschen, dass Sportpsychologie – wo nötig und sinnvoll - ähnlich selbstverständlich integriert wird, wie eine Ernährungsberatung oder Physiotherapie. Das ist in vielen Situationen auch schon der Fall und es hat sich nach meinem Empfinden in den letzten Jahren auch viel getan. Gleichzeitig habe ich immer noch den Eindruck, dass das Wort „Psyche“ in vielen Sportler*innen eher ein mulmiges Gefühl auslöst – sicher auch in vielen anderen Menschen in unserer Gesellschaft.
Zu hart zu sich selbst
Und ich erlebe auch immer noch viele Situationen, in denen psychische Probleme, Zweifel oder Ängste als Schwäche wahrgenommen werden. Viele Leistungssportler*innen beißen sich da lieber durch nach dem Motto „einfach mehr trainieren, noch härter zu sich selbst sein, durchbeißen“. Das ist aber nicht die Lösung, sondern oft Teil des Problems, z.B. wenn ohnehin schon ein Erschöpfungszustand vorliegt, wegen dem die Leistung nicht mehr erbracht wird.
„Go hard or go home“, das ist eins dieser gefeierten Narrative v.a. bei uns im Laufsport und es mag inspirierend und romantisch klingen, aber wer immer Vollgas gibt und sich nicht die Zeit gönnt, mental, körperlich und sozial zu regenerieren, der trainiert sich irgendwann in ein Loch der Erschöpfung.
Profisport während der Pandemie
Aus der Routine geworfen
Wahrscheinlich hatte sich Deine Arbeit durch die Corona Pandemie stark verändert, oder?
Ja, sehr, vor allem im ersten Jahr. Für mich beruflich hieß das, dass Coachings monatelang fast nur online stattfinden konnten, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Als Sportpsycholog*innen mit vielen Klient*innen waren wir ja quasi „Superspreader“. Aber auch die Gesamtsituation war eine echte Herausforderung.
Es ist für uns alle schwierig, wenn unsere Alltagsstruktur plötzlich unterbrochen wird. Bei Sportler*innen war das auch der Fall: geschlossene Sportstätten, Restriktionen im Trainingsablauf, abgesagte Wettkämpfe, egal ob national oder international, die Sorge um die unbekannten Langzeitfolgen der Erkrankung und vor allem die ständige, nicht endende Unsicherheit, wann man endlich wieder normal planen kann.
Normalerweise ist ein Alltag im Hochleistungssport ja strikt durchgetaktet und geplant. Belastungs- und Erholungsphasen wechseln sich ab, Trainingslager werden strategisch gewählt, die zeitliche Planung richtet sich an den Saisonhöhepunkten aus. Diese Ziele sind auch notwendig, um eine mentale Spannungskurve aufzubauen, um Disziplin und Motivation aufrecht zu erhalten. Plötzlich war vieles davon nicht mehr möglich. Das mündete dann in der Verschiebung der Olympischen Spiele 2020.
Worst Case Scenario
Für Diejenigen, die sich auf Olympia vorbereiteten, fühlte sich das vermutlich an wie ein Zug, der aus voller Fahrt eine Notbremsung hinlegen muss. Und mit einem so plötzlichen Stillstand klarzukommen ist schwer, wenn man gewohnt ist, in Bewegung zu sein.
Dazu kam bei vielen auch finanzielle Unsicherheit. In 2020 liefen einige Ausrüsterverträge aus. Durch fehlende Wettkämpfe konnten teilweise aber nicht die üblichen Leistungsnachweise erbracht werden und dadurch baut sich natürlich Druck auf, vor allem, wenn die Saison davor nicht besonders erfolgreich war. In den meisten Sportarten, über die wir hier sprechen, ist der Sport ein großer Teil des Einkommens und mit fehlenden Wettkämpfen stieg auch die Angst, davor, dass Sponsoren abspringen könnten.
Und dann war da natürlich die große Unsicherheit rund um COVID-19 als Erkrankung. Welche Auswirkung eine Coviderkrankung mit sich bringen kann, ist jetzt (natürlich) immer noch nicht ausreichend erforscht und inzwischen sind ja auch Beispiele von Sportler*innen bekannt, die nach einer Erkrankung nicht mehr an alte Leistungen anknüpfen konnten und ihre Karriere beenden mussten.
Heilende Wirkung nur bis zu einem bestimmten Punkt
Immer an der Grenze
Uns interessiert aktuell insbesondere die heilende Wirkung des Laufens auf die Psyche des Menschen, wie sind Deine Erfahrungen, sowohl persönlich als auch mit den Menschen, mit denen Du arbeitest?
Ich glaube, es ist sinnvoll, dabei zwischen Laufen als Freizeitsport und Laufen als Leistungssport zu unterscheiden. Viele Studien belegen inzwischen die positive Wirkung von regelmäßigem Lauftraining auf die körperliche und mentale Gesundheit. Das ist glaube ich auch den meisten bekannt.
Je mehr jemand läuft, desto mehr positive Effekte sind auch zu erwarten. Allerdings verläuft dieses Verhältnis nicht linear, ab einem bestimmten Punkt kann noch mehr Lauftraining der körperlichen und mentalen Gesundheit auch schaden. Und in diesem Bereich bewegen sich Hochleistungssportler*innen teilweise auch.
Meine körperlichen und mentalen Grenzen zu verschieben, erfordert eben, Risiken einzugehen und mit Risiken steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Belastung mal zu hoch ist und eine Verletzung entsteht oder eine Einschränkung der mentalen Gesundheit die Folge ist. Das ist Teil vom Leistungssport.
Laufsport selbst hat unter anderem antidepressive Effekte. Wir wissen allerdings, dass bei Leistungssportler*innen, die länger verletzt sind, die Wahrscheinlichkeit für eine Depression steigen kann. Oder dass bei längeren Phasen mit hoher Trainingsbelastung das Risiko für ein Übertraining steigt, das auch mit depressiven Symptomen einhergehen kann.
Laut Studien treten psychische Erkrankungen im Leistungssport allerdings genauso häufig auf wie in der Gesamtgesellschaft. Als Sportpsychologin darf ich Sportler*innen mit psychischen Erkrankungen übrigens auch gar nicht betreuen – ich vermittle in solchen Fällen dann immer an unsere psychotherapeutischen Anlaufstellen.
Stress und Druck "on top"
Außerdem kommt im Leistungssport der Umgang mit Druck und Stress hinzu, der durch den Leistungsvergleich entstehen kann. Auch ambitionierte Freizeitläufer*innen haben teilweise so viel Angst vor Rennen, dass es ihnen dadurch richtig schlecht geht. Mit dieser Herausforderung haben manche Profi’s auch zu tun, denn der Umgang mit Stresssituationen ist super individuell und hat viel mit den Erfahrungen zu tun, die wir gemacht haben.
Als Sportpsycholog*innen haben wir in solchen Fällen viele potenzielle Herangehensweisen – je nachdem was der Sportlerin oder dem Sportler gerade hilft. Das können Vorstellungstechniken sein, emotionsregulierende Techniken, wie z.B. Entspannungstechniken, oder auch eine veränderte Zielsetzung mit kleineren sich langsam steigernden Zielen und einem stärkeren Fokus auf das „Wie“, anstelle dem „Was“: „wie möchte ich den Wettkampf laufen?“, anstelle von „was kann ich in dem Wettkampf erreichen?“.
Hilfe finden und annehmen
Es ist viel passiert
Wer sonst könnte Deiner Meinung nach einen Beitrag leisten, um diesen wichtigen Aspekt in Deutschland mehr zu fördern? Politik? Krankenkassen? Verbände?
Ich finde, es wird schon viel getan, um die Aufmerksamkeit für psychische Erkrankungen und ein eingeschränktes mentales Wohlbefinden zu steigern. Dazu hat sicher auch die COVID-19-Pandemie beigetragen. Rund um die Olympischen Spiele 2020 im letzten Jahr und auch davor haben sich zum Beispiel viele Athlet*innen öffentlich zu dem Thema geäußert und ihre eigene Geschichte erzählt.
Gleichzeitig finde ich nicht, dass wir es selbstverständlich von Hochleistungsportler*innen erwarten dürfen, öffentlich darüber zu sprechen, wenn es ihnen mental nicht gut geht. Es wäre nicht fair, sie die Hauptverantwortung dafür schultern zu lassen, dass sich die (Sport-)Gesellschaft mehr Gedanken über mentale Gesundheit macht.
Hilfe für Sportler*innen
Es braucht dazu vermutlich viel mehr Akteure, die sich in vielen unterschiedlichen Rollen und damit auch Einflussbereichen befinden. Ich finde die Initiative von Athleten Deutschland e.V. – einer unabhängigen Interessenvertretung von Bundeskaderathlet*innen in Deutschland – super, das sogenannte „Zentrum für Safe Sport“ zu gründen.
Hierhin können sich Leistungssportler*innen wenden, die psychische, physische oder sexualisierte Gewalt im Sport erlebt haben: LINK
Eine weitere tolle Initiative ist auch Athletes in Mind. Auf dieser Website werden von Kolleg*innen Ressourcen rund um die mentale Gesunderhaltung im Sport zusammengetragen – Informationen, Kontakte, Beispiele aus dem Sport und Anregungen zur Leistungsverbesserung und Gesunderhaltung.
Ich denke, je mehr Initiativen dieser Art es gibt und je offener über das Thema mentale Gesundheit gesprochen wird, desto mehr erlauben wir es uns selbst auch, nicht nur ehrlich mit uns umzugehen, sondern auch Hilfe anzunehmen, wenn wir sie brauchen.
Vielen Dank für den Einblick in Deine Welt, Mari.